Betonkirche, Seelenbunker, Bet-Zelt – es gibt viele Spottworte für Kirchenbauten der ersten Nachkriegszeit. Die scharfe Kritik an der „brutalistischen“ Architektur, an anonymen Hochhauswohnsiedlungen, am autogerechten Städteumbau verbindet sich dabei oft zu einer generellen Zeitkritik.
Übersehen wird jedoch, dass es in dieser Epoche der Architekturgeschichte nicht weniger Einfalls- und Formenreichtum gab als in anderen. Kaum jemals wurde architektonisch derart viel erprobt und gewagt wie in der Zeit von Kriegsende bis Mitte der siebziger Jahre.
Dabei liegt der baukünstlerische Wert dieser Kirchen auch in der Hoffnung und dem Willen, die Zukunft mittels der gebauten Moderne sicher und nachhaltig zu gestalten.
Der Fotograf Patrick Voigt begibt sich auf die Entdeckungsreise zu dramatischen und kraftvollen Kirchenbauten im einstigen West-Berlin, begleitet von dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau.
Beton und Glaube bietet eine aktuelle Übersicht schützenswerter Kirchen der Nachkriegsmoderne und regt zu einem sinnvollen Umgang mit diesem kulturellen Erbe an.
Architekten
Reinhold Barwich Paul G. R. Baumgarten Fritz Bornemann Ulrich Craemer Werner Düttmann Friedrich Ebert Egon Eiermann Klaus H. Ernst Hermann Fehling Bodo Fleischer Daniel Gogel Dietmar Grötzebach Karl Hebecker Reinhard Hofbauer Hermann Jünemann Michael König Sigrid Kressmann-Zschach Willy Kreuer Peter Lehrecke Wilhelm Lehrecke Ludwig Lemmer Werner March Gerd Neumann Frei Otto Peter Pfankuch Hansrudolf Plarre Günther Plessow Konrad Sage Hans Schädel Ludolf von Walthausen
Kirchen
Gedenkkirche
Maria Regina Martyrum
Hans Schädel, Friedrich Ebert
1963





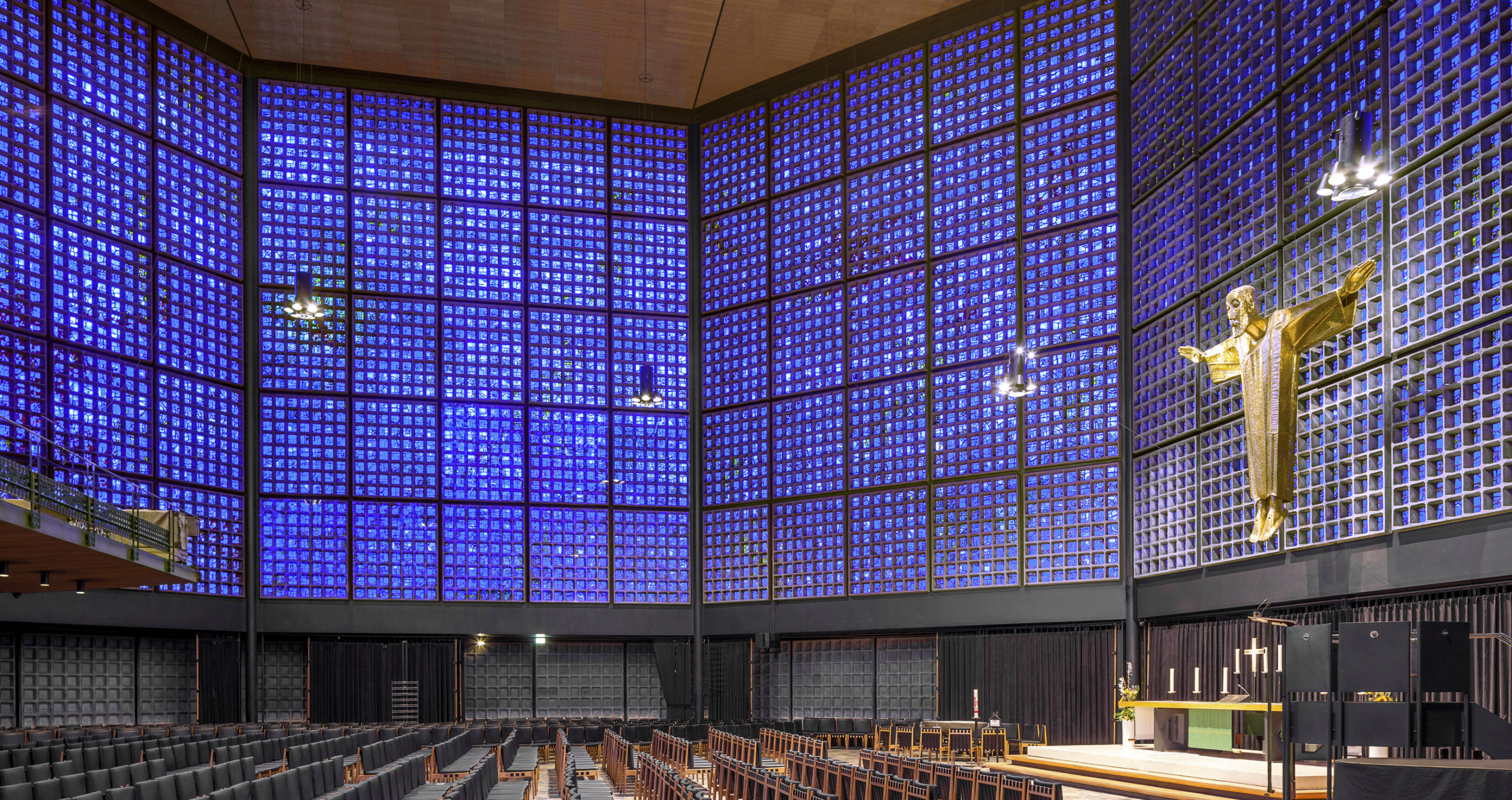





















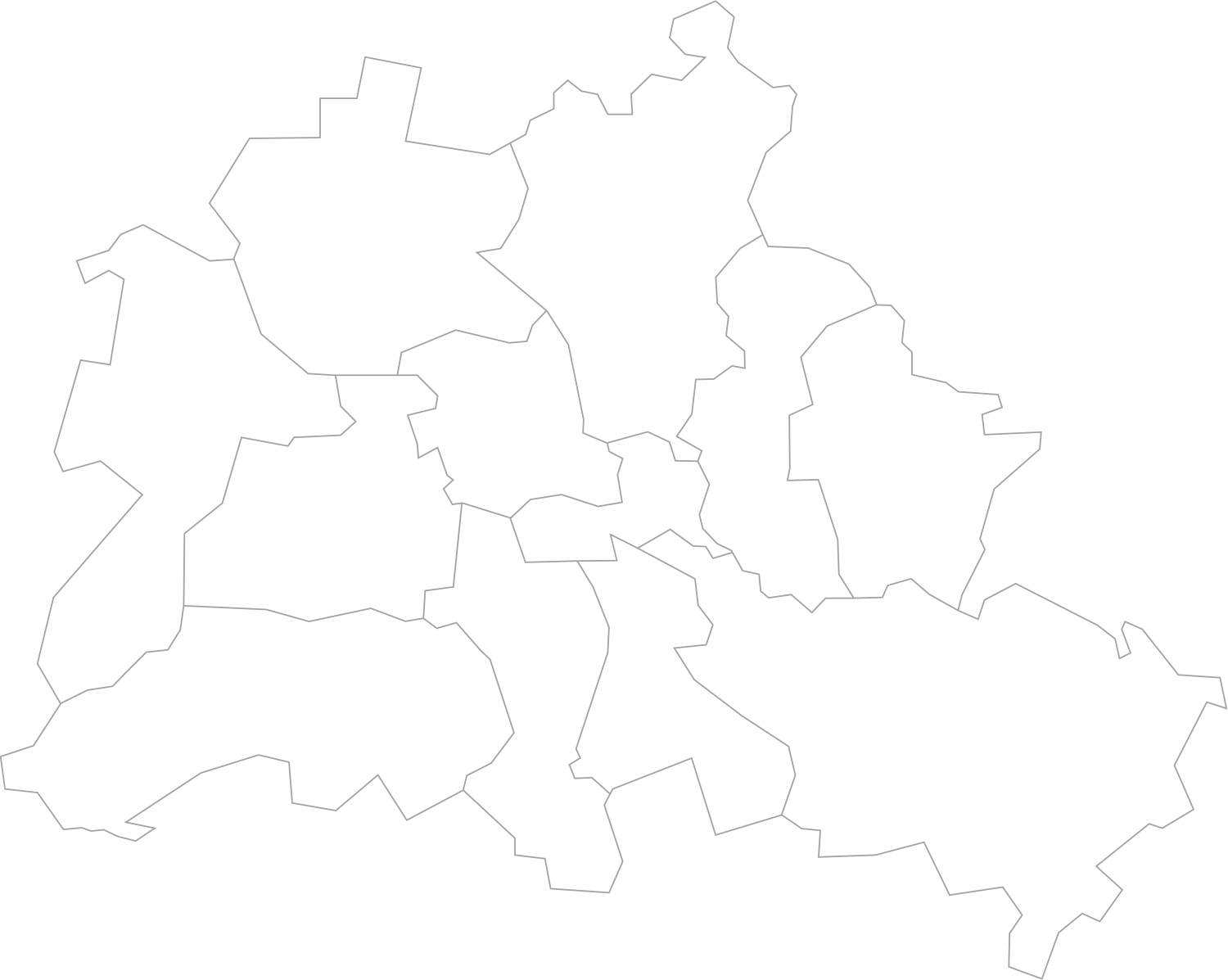
 Fritz Bornemann
Fritz Bornemann
 Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach, Günther Plessow
Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach, Günther Plessow Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach, Günther Plessow
Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach, Günther Plessow
 Bodo Fleischer
Bodo Fleischer Bodo Fleischer
Bodo Fleischer Ulrich Craemer
Ulrich Craemer Konrad Sage, Karl Hebecker
Konrad Sage, Karl Hebecker Ludolf von Walthausen
Ludolf von Walthausen Willy Kreuer
Willy Kreuer Ludwig Lemmer
Ludwig Lemmer Paul G. R. Baumgarten
Paul G. R. Baumgarten Egon Eiermann
Egon Eiermann Sigrid Kressmann-Zschach
Sigrid Kressmann-Zschach Klaus H. Ernst
Klaus H. Ernst Werner Düttmann
Werner Düttmann Werner March
Werner March Hermann Fehling, Daniel Gogel, Peter Pfankuch
Hermann Fehling, Daniel Gogel, Peter Pfankuch Hermann Fehling, Daniel Gogel, Peter Pfankuch
Hermann Fehling, Daniel Gogel, Peter Pfankuch Reinhard Hofbauer
Reinhard Hofbauer Michael König
Michael König Peter Lehrecke, Wilhelm Lehrecke
Peter Lehrecke, Wilhelm Lehrecke Frei Otto
Frei Otto Reinhold Barwich
Reinhold Barwich Hans Schädel, Hermann Jünemann
Hans Schädel, Hermann Jünemann